
Im Fricktal ist oberhalb von 600m auch noch weiss aber wie viel noch da liegt weiss ich nicht.
Werbung




Von den 20 cm vor einer Woche sind 3 cm übrig geblieben. Und die Umgebung zeigt noch einiges Weiss auf den Dächern und den Feldern. Dem dichten Nebel sei Dank, der seit 2 Tagen über dem Dorf klebt und die Temperatur bis heute wieder knapp unter den Gefrierpunkt absinken liess. Aber unsere 88-jährige Nachbarin meinte klipp und klar, "Nein, das ist keine weisse Weihnachten", und sie muss es ja wissen.Also wenn ich die 20 cm Schnee draussen sehe, dann glaube ich wiedermal an weisse Weihnachten.

Diese Feststellung möchte ich noch dokumentieren, und zwar anhand des Temperaturverlaufs der Station ZH Fluntern. Die Temperatur ist in den letzten 3 Tagen kontinuierlich gesunken, obwohl es zeitgleich in der Höhe durch Hochdruckeinfluss wärmer wurde, siehe den Temperaturverlauf auf dem Hörnli. Dieses Absinken der Temperatur unterhalb des Nebels ist für mich nicht 100% nachvollziehbar. Entweder fliesst von irgendwoher kontinuierlich kältere Luft nach (nicht nachgeprüft), oder es sind Strahlungsbilanzprozesse am werkeln, bei welchen ich nicht so richtig den Durchblick habe. Unten gibt es einen Wärmeverlust, aber wohin geht diese Wärme? Der Boden wird nur dann Wärme nach oben abstrahlen, wenn kein oder nur wenig Nebel vorhanden ist.Dem dichten Nebel sei Dank, der seit 2 Tagen über dem Dorf klebt und die Temperatur bis heute wieder knapp unter den Gefrierpunkt absinken liess.
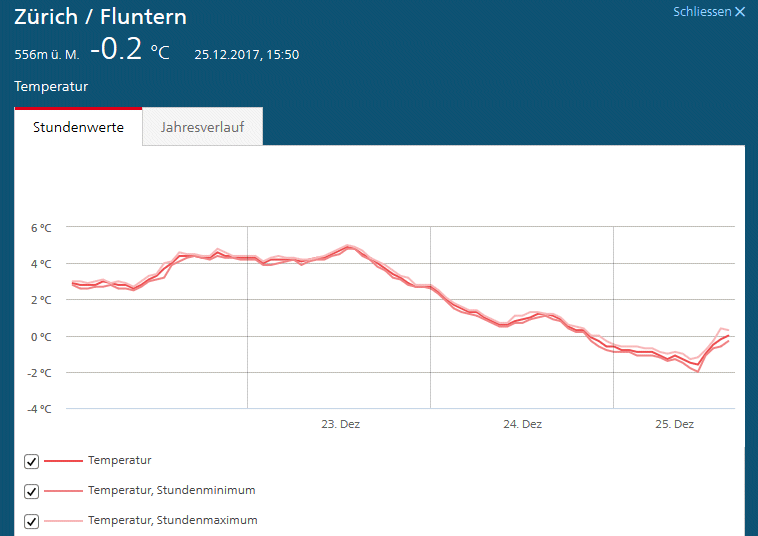
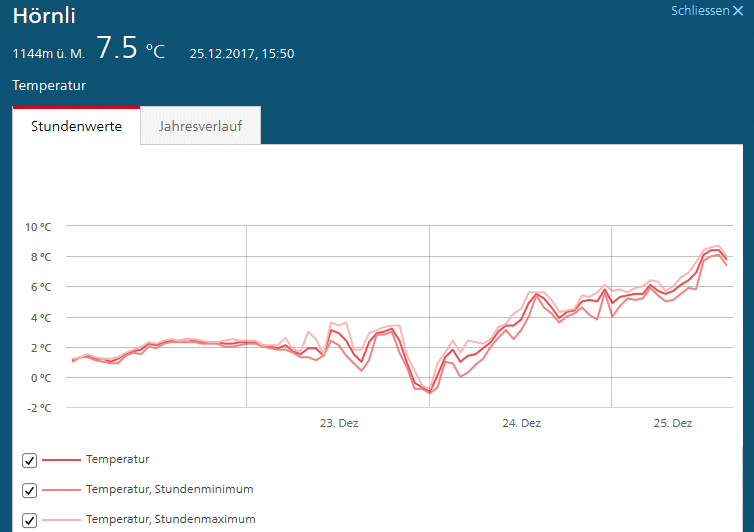
Werbung