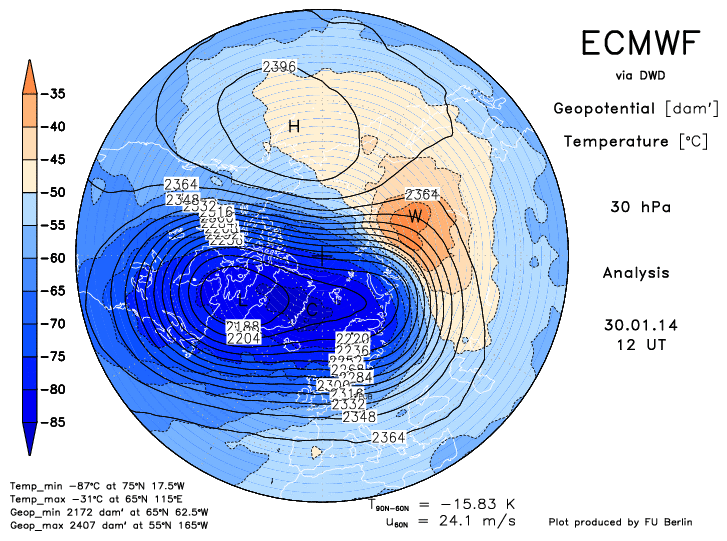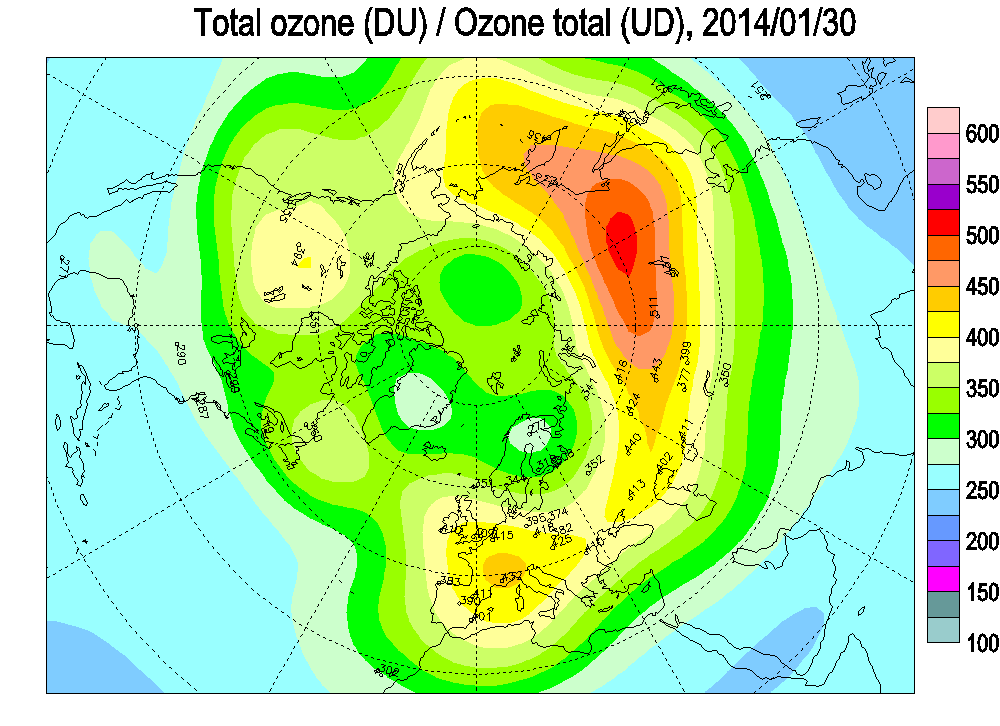Hallo Silas
Sehr spannendes Thema. Bin mir aber auch nicht sicher ob das wirklich Perlmutterwolken sind.
Hab ein wenig "gegoogelt" und einiges gefunden (z.B. Link unten).
Ich denke, wenn wir herausfinden könnten, wie kalt (es braucht min. ca. -85°dafür) es zu dieser Zeit dort Oben war, hätten wir schon eine relativ guten Hinweis für Pro oder Kontra.
Bin gespannt ob wir da noch was rauskriegen. Eine Sichtung in unseren Breiten wär schon was!.... So oder so, aber eine schöne Stimmung!
Grüsse Crosley
Quelle:
http://www.meteoros.de/psc/psc.htm
Polare Stratosphärische Wolken (PSC - Polar Stratospheric Clouds) treten in der Stratosphäre in einer Höhe zwischen 20 und 30 km auf. Die Voraussetzung für die Entstehung von PSC sind sehr geringe Temperaturen, weshalb sich ihr Vorkommen auf die Wintermonate und im wesentlichen auf Skandinavien, Schottland, Alaska oder die Antarktis beschränkt.
Es werden allgemein zwei Haupttypen von Polaren Stratosphärischen Wolken unterschieden:
1.Typ 1: Mischwolken
1a) Nitric Acid Trihydrate (NAT)
Kondensierende feste "Nitric Acid Trihydrate" Partikel können bereits bei relativ hoher Umgebungstemperatur (-78°C in 50hPa) auftreten. Die mikroskopische Struktur der Partikel ist chemisch eine Verbindung von je einem Molekül HNO3 mit 3 Molekülen Wasser - einem sogenannten Trihydrat der Formel HNO3* 3H20. Ihre Teilchengröße ist etwa 1 µm (1 millionstel Meter). Bei tieferen Temperaturen können sie weiter wachsen und dann auch relativ geringe Mengen an Salzsäure (HCl) und Schwefelsäure (H2SO4) aufnehmen. Das Aussehen der NAT-Wolken wird als sehr feingliedrig (ähnlich dem der NLC-Wolken) beschrieben und sie treten häufig sehr großflächig auf.
1b) Supersaturated Ternary Solution (STS)
Diese PSC bestehen hauptsächlich aus den flüssigen Partikeln einer übersättigten ternären Lösung von Schwefelsäure, Salpetersäure und Wasser. Ihr Aussehen ähnelt Wolkenschlieren, Strukturen sind oft nicht erkennbar. Meist ist ihr Auftreten deshalb nur durch Messungen nachweisbar.
2.Typ 2: Perlmutterwolken
PSC's des Typs 2 bestehen aus reinen Wasser-Eiskristallen. Sie bilden sich bei tieferen Temperaturen, nämlich bei -85°C bis -90°C und weniger (188 K in 25 km Höhe). Ihre Teilchengröße ist ungefähr 10 µm. Die Eiskristalle sind daher so schwer, daß diese PSC dazu neigen, in die Troposphäre abzusinken. Die eh schon sehr wasserarme Stratosphäre wird so über den Polen weiter dehydriert. Dieser PSC-Typ, auch Perlmutterwolken genannt, haben ein meist linsenförmiges Aussehen und treten nur kleinräumig auf.
Perlmutterwolken
Als Perlmutterwolken beschreibt man ein meist pastellfarbenes Irisieren an kleinsten Eiskristallen linsenförmiger Wolken in 20 bis 30 km Höhe. Ihre beste Sichtbarkeit erreichen sie kurz vor Sonnenuntergang bzw. kurz nach Sonnenaufgang in 10 bis 20° Entfernung von der Sonne. Allerdings können sie auch noch bis 2 Stunden nach Sonnenuntergang beobachtet werden, was darauf hindeutet, daß sie sich in großer Höhe befinden. Sie entstehen, wenn eine Luftströmung ein Hindernis, etwa ein Gebirge überströmt. Dadurch beginnt die Luftströmung zu schwingen und auf der windabgewandten Seite bilden sich bei stabiler atmosphärischer Schichtung stehende Wellen aus. In diesen Leewellen strömt die Luft mehrmals abwechselnd nach oben und nach unten. In den Teilstücken mit Aufwärtsbewegung dehnt sich die Luft aus und kühlt sich dabei ab. Dadurch kann Wasserdampf kondensieren und es bilden sich Wolken. In den nördlichen Breiten reicht die Wellenbildung aufgrund der extrem stabilen atmosphärischen Schichtung bis in die obersten Schichten der Atmosphäre. Da die Temperaturen dort aber nur selten so tief fallen, entstehen nur hin und wieder Perlmutterwolken. In der Arktis und Antarktis sind sie nach neueren Kenntnissen im Winter hingegen häufiger als bisher angenommen.
Es wird vermutet, daß Staub in der Stratosphäre die Bildung von Perlmutterwolken begünstigt, da sich kleine Staubpartikel gut als Sublimationskerne von Wassermolekülen eignen. In Skandinavien können Perlmutterwolken in fast jedem Winter beobachtet werden. Die finnischen Beobachter können dank des westwindabfangenden Skandinavischen Gebirges immerhin auf über 50 Erscheinungen in 12 Jahren zurückblicken. Ob Perlmutterwolken auch in Deutschland möglich sind, darüber konnte man bisher nur spekulieren. Die theoretischen Bedingungen sind im Winter mitunter auch in unseren Breiten gegeben, vor allem im Norden Deutschlands, wo das Klima der höheren Luftschichten noch durch das skandinavische Gebirge beeinflußt wird. Jedoch gibt es kaum Beobachtungsberichte aus Deutschland. Auch aus der Literatur ist nur ein derartiger Fall bekannt. Es wurde in den deutschen "Astronomischen Nachrichten" von 1910 darüber berichtet, daß am 19.05.1910, kurz nach Komet Halleys Vorbeiflug solche Wolken beobachtet worden sind.