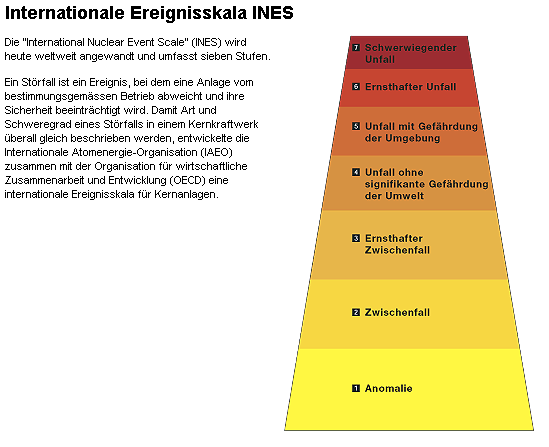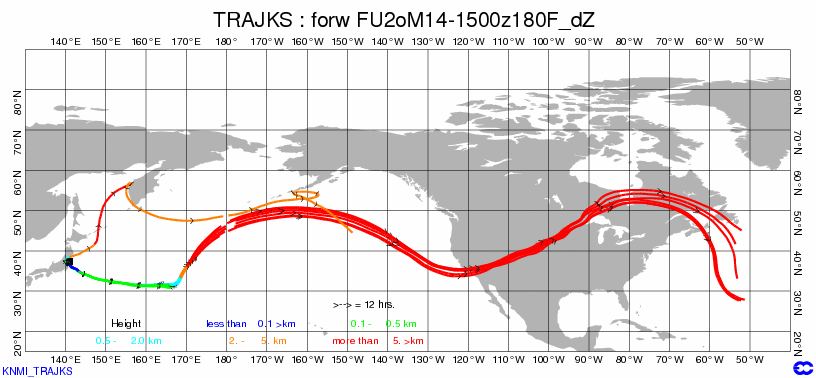Zitat: Tages Anzeiger
«Wir schaffen nur 18 Tote am Tag»
Mit Spitzhacken arbeiten sich in Japan Bergungstrupps durch die Trümmer, um Tote zu bergen. Leichensäcke werden knapp, Krematorien kommen an ihre Grenzen. Den Überlebenden fehlten Wasser und Nahrung.
Millionen Überlebende hatten am Montag die dritte Nacht in Folge bei Temperaturen nahe am Gefrierpunkt ohne Heizung, ohne Wasser und Nahrung hinter sich. Die doppelte Katastrophe aus Erdbeben und Tsunami am Freitag hat viele Japaner in eine Notlage gestürzt, wie sie die Wirtschaftsnation seit Kriegsende nicht erlebt hat.
«Die Menschen leben von ein bisschen Nahrung und Wasser. Es kommt einfach nichts an», sagte Hajime Sato, ein Verwaltungsbeamter aus der mit am schlimmsten betroffenen Präfektur Iwate. Die Behörden erhielten nur ein Zehntel der benötigten Lebensmittel und anderen Versorgungsgüter.
Selbst Leichensäcke und Särge würden so knapp, dass die Behörden sich womöglich an das Ausland um Hilfe wenden müssten. «Wir haben Beerdigungsunternehmen im ganzen Land gebeten, uns viele Leichensäcke und Särge zu schicken. Aber wir haben einfach nicht genug», erklärte Sato. «Wir haben schlicht nicht erwartet, dass so etwas passiert. Das überwältigt einen einfach.»
1000 Leichen angeschwemmt
An den Stränden der Präfektur Miyagi wurden nach Polizeiangaben rund 1000 Leichen angespült. Damit erhöht sich die feststehende Zahl von Todesopfern auf 2800, doch tatsächlich dürfte sie viel höher sein. Allein in Miyagi mit 2,3 Millionen Einwohnern rechnet der Polizeichef mit über 10'000 Toten.
In Soma in der Nachbarprovinz Fukushima konnte das Krematorium den Andrang nicht mehr bewältigen. «Wir haben schon mit den Einäscherungen begonnen, aber wir schaffen nur 18 Tote am Tag. Wir sind überfordert und bitten andere Orte, uns mit den Leichen zu helfen. Wir haben nur ein Krematorium am Ort», sagte Katsuhiko Abe von der Stadtverwaltung.
In Japan werden Verstorbene meist verbrannt; das bedarf wie bei einer Beerdigung einer amtlichen Genehmigung. Die Regierung hob diese Vorschrift am Montag aber auf, um die Beisetzung der Opfer zu beschleunigen.
«Die derzeitige Lage ist so aussergewöhnlich, und sehr wahrscheinlich stossen die Krematorien an ihre Grenzen», sagte ein Vertreter des Gesundheitsministeriums. «Das ist eine Notmassnahme. Wir wollen den vom Erdbeben betroffenen Menschen helfen, so gut wir können.»
Endlose Szene der Verwüstung
Erstmals seit der Katastrophe trafen in Soma Suchtrupps ein, um Leichen zu bergen. Auf einem von Trümmern freigeräumten Platz warteten Leichensäcke und Krankenwagen.
Mit Sägen und Äxten arbeiteten sich Feuerwehrleute durch ein unbeschreibliches Gewirr aus Holzbalken, Plastikplanen, Dachteilen, Schlamm, Autowracks, verknäulten Kabeln und Haushaltsgegenständen. Helikopter erkundeten aus der Luft die endlose Szene der Verwüstung.
Noch einen Kilometer landeinwärts lagen fortgeschleuderte Boote neben der Strasse. Nach Behördenangaben wurde die 38'000 Einwohner zählende Stadt zu einem Drittel überflutet; tausende Menschen würden vermisst.
Benzin nur für Einsatzfahrzeuge
«Ich gebe die Hoffnung auf», stöhnte der Bauarbeiter Hajime Watanabe. Er stand ganz vorne in der Schlange an einer geschlossenen Tankstelle in Sendai, rund 100 Kilometer nördlich von Soma. Da kam jemand von den Rettungskräften herüber und brachte ihm bei, dass - sollte die Tankstelle überhaupt öffnen - Sprit nur an Einsatz- und Behördenfahrzeuge abgegeben werde.
«Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir mal in so eine Lage kommen», sagte Watanabe. «Vorher hatte ich ein gutes Leben. Jetzt haben wir gar nichts: kein Gas, keinen Strom, kein Wasser.»
Immerhin kann seine Familie noch auf 60 Halbliterflaschen Wasser zurückgreifen, die seine Frau für Notfälle wie diesen gebunkert hatte. Zwei Stunden lang lief er durch die Gegend, bis er einen offenen Laden fand, und stand Schlange für Instantnudeln.
Zwei Millionen Haushalte ohne Strom
Mindestens 1,4 Millionen Haushalte sind von der Wasserversorgung abgeschnitten, 1,9 Millionen ohne Strom. Dem Fernsehsender NHK zufolge haben 310'000 Menschen in Notunterkünften oder bei Verwandten Zuflucht gefunden, 24'000 sind irgendwo gestrandet.
Die Regierung hat 100'000 Soldaten zum Hilfseinsatz beordert und 120'000 Decken, 120'000 Flaschen Wasser und 110'000 Liter Benzin sowie Lebensmittel ins Katastrophengebiet geschickt.
Es kann allerdings noch Tage dauern, bis es wieder Elektrizität gibt. Ein Grund für den Stromausfall ist der Schaden am Atomkraftwerk Fukushima-Daiichi - wo sich vielleicht gerade die nächste Katastrophe zusammenbraut.
(pbe/sda)
Erstellt: 14.03.2011, 20:06 Uhr
http://www.tagesanzeiger.ch/mobile/ausl ... index.html
________________________
FOTOS
http://www.sueddeutsche.de/wissen/japan ... -1.1071586
________________________
Zitat Spiegel.de
Risiko Wetter
Wind bläst radioaktive Wolke nach Tokio
Von Markus Becker
Bislang wurde Tokio von dem Atomunfall weitgehend verschont - jetzt könnte sich das ändern: Der Wind dreht auf Nordost. Meteorologen glauben, dass er die Radioaktivität aus dem AKW Fukushima in dieser Nacht in die Millionenstadt trägt. Wie hoch wird die Strahlenbelastung sein?
Es ist Frühjahr in Japan, normalerweise eine Zeit für Westwind. Doch derzeit scheint nichts normal zu sein in Japan. Ausgerechnet in der Nacht zum Dienstag - zum Zeitpunkt einer drohenden Kernschmelze im Atomkraftwerk Fukushima - wird der Wind den Prognosen zufolge auf Nordost drehen. Eine aktuelle Modellrechnung der Wiener Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zeigt, dass die Luftströmungen die radioaktiven Stoffe aus dem AKW südwestwärts treiben werden - genau auf das 240 Kilometer entfernte Tokio zu. Erst nachdem die Wolke die Hauptstadt und ihre 35 Millionen Einwohner überquert hat, wird sie den Berechnungen zufolge einen Bogen nach Osten schlagen und aufs Meer hinauswehen - siehe Grafik:
Die radioaktive Wolke soll am 15. März über Tokio sein.
Wie stark die Strahlung wird, hängt von der weiteren Freisetzung am beschädigten AKW Fukushima ab.
In den vergangenen Tagen haben die Ingenieure in dem havarierten AKW mehrfach radioaktiven Dampf aus den Reaktordruckbehältern abgelassen, um Schlimmeres zu verhindern. Bisher wehte der Wind die strahlende Wolke aufs offene Meer. Das ändert sich nun, wie Windprognosen mehrerer Wetterdienste besagen.
Am Montagabend 20 Uhr deutscher Zeit - in Japan ist es dann Dienstag vier Uhr früh - werde die Wolke voraussichtlich über Tokio ankommen, sagt ZAMG-Meteorologe Gerhard Wotawa. Die Vorhersagen hält er für inzwischen recht zuverlässig: "Es ist nicht zu erwarten, dass sich daran noch viel ändert. Tokio wird nach derzeitigem Stand der Dinge auf jeden Fall Radioaktivität abbekommen."
Wer glaubt, mehr Pech könne niemand haben, sieht sich getäuscht - die Natur hält noch zwei weitere Hiobsbotschaften für Tokio bereit:
* Zum einen ist sehr schwacher Wind mit Geschwindigkeiten von nur 10 bis 20 km/h vorhergesagt. "Das bedeutet, dass die radioaktive Wolke lange über Tokio hängen wird", sagt Wotawa.
* Obendrein soll es in der Stadt ab Dienstagnachmittag Regen geben, der eineinhalb bis zwei Tage andauert. Dadurch würde ein beachtlicher Teil der strahlenden Partikel auf den Erdboden gelangen. "Das ist die ungünstigste Wetterlage, die man sich vorstellen kann", sagt Wotawa im Gespräch mit SPIEGEL ONLINE. "Viel schlimmer geht es eigentlich nicht mehr."
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natu ... 35,00.html
__________________________________________________________
Zitat: Tages Anzeiger
«Dann beginnt das nächste Problem»
Interview: Reto Knobel . Aktualisiert um 18:28 Uhr
Der Schweizer Atomphysiker Stephan Robinson vergleicht den AKW-Unfall von Japan mit denjenigen von Tschernobyl und Harrisburg. Und schildert das grösste Problem bei den anstehenden Aufräumarbeiten.
Stephan Robinson, vor 25 Jahren ereignete sich in Tschernobyl der bislang grösste Atomunfall. Kann man eine Bilanz ziehen?
Das verstrahlte Gebiet damals war etwa 40'000 Quadratkilometer gross, das entspricht etwa der Fläche der Schweiz. 5 Millionen Leute waren betroffen. Theoretisch kann man ausserhalb einer 30-Kilometer-Zone rund um das Atomkraftwerk wieder leben.
Theoretisch?
Es hat dort immer noch sehr viele langlebige Radio-Nuklide, die in den Körper aufgenommen werden können, weshalb das Gebiet in den nächsten 300 bis 1000 Jahren nur eingeschränkt bewohnbar und wirtschaftlich nutzbar ist.
Wie gefährlich ist die Strahlung ein Vierteljahrhundert nach dem Unfall?
Die Menschen rund um Tschernobyl leiden immer noch unter den Spätfolgen. Drei Stoffe sind besonders gefährlich. Da ist erstens Radio-Iod. Glücklicherweise ist nach den ersten 100 Tagen das Iod weitgehend zerfallen und heute nicht mehr anzutreffen. Radioaktives Iod hat aber in den ersten Monaten und Jahren nach dem Unfall zu einer Häufung von Schilddrüsenkrebs geführt. Viel bedrohlicher sind heute Radio-Caesium und Radio-Strontium. Caesium ist Kalium chemisch gleichartig und wird vom Körper in Muskeln und verschiedenen Organen eingebaut - aber mit der Zeit auch wieder ausgeschieden. Es ist heute die wichtigste Komponente der Strahlungsaufnahme. Am schlimmsten ist die Wirkung des dem Kalzium chemisch sehr ähnlichen Strontium, das sich in Knochen ansammeln kann und unter anderem Leukämie auslösen kann.
Ein paar Monate nach der Tschernobylkatastrophe legte man einen ersten Beton-Sarkopharg über das AKW. Hält er dicht?
Er ist mürbe, geschädigt von Wetter und Strahlung. Der Mantel droht zusammenzubrechen, darum wurde der Bau eines zweiten Deckels beschlossen.
Eine Baumassnahme, die irgendwann auch die Verantwortlichen in Japan prüfen müssen?
Bei allem Schrecken und Leid: Nach jetzigem Wissensstand ist die Welt mit einem blauen Auge davongekommen. Das sogenannte Containment - eine Schutzhülle um die eigentliche Reaktorhülle - hält offenbar bisher weitgehend.
Es kam aber zu verschiedenen Wasserstoffexplosion im dritten Reaktorblock des havarierten AKW Fukushima, es wurde radioaktiver Dampf in die Umgebung freigesetzt. Was sagt Ihnen das?
Wie gesagt: Die Reaktoren scheinen inwendig beschädigt zu sein. Der Cocktail von freigesetzten Radionukliden deutet auf eine Kernschmelze hin. Mehr kann ich im Moment dazu nicht sagen. Im schlimmsten Fall, falls doch noch massive Mengen von radioaktiven Materialien austreten sollten, würden viele Quadratkilometer Land wie in der Ukraine und Weissrussland 300 bis 1000 Jahre nur sehr eingeschränkt bewohnbar sein.
Wie geht es jetzt in Japan weiter?
Die beschädigten Reaktoren müssen lange, sehr lange überwacht werden. Nach dem Unfall von Three Mile Island im März 1979 strahlten die Reaktoren noch so stark, dass man erst nach 5 Jahren mit dem Abbau anfangen konnte – dieser dauerte dann nochmals fast 10 Jahre. Auch in Japan wird es viele Jahre dauern, bis die Strahlungsniveaus so weit gesunken sind, dass man ans Aufräumen denken kann.
Und dann?
Dann beginnt das nächste Problem. Wohin soll man mit all dem radioaktiven Schrott? Der Abbau und die Endlagerung werden eine grosse Herausforderung sein. Da die radioaktiven Materialen alle miteinander verschmolzen sind, muss jeder Schritt ganz genau geplant werden. Die jahrzehntelange Überwachung, Demontierung und Lagerung ist aufwendig und wird Kosten im Milliardenbereich verursachen. Gleichzeitig fallen mit der durch das Erdbeben bedingten Abschaltung von 11 Atomreaktoren etwa 6 Prozent der japanischen Energieproduktion weg. Das entspricht gemäss unserer Schätzung der Leistung von 8 Leibstadt-Atomkraftwerken.
Kann dieser Ausfall ersetzt werden?
Kurzfristig nicht. Die erneute Inbetriebnahme der noch funktionierenden Atomreaktoren dauert mindestens drei Monate. Die Anlagen müssen vollständig inspiziert und vielleicht überholt werden. Im schlimmsten Fall wurden die notabgeschalteten Reaktoren durch das Erdbeben mechanisch so stark beschädigt, dass sie nie mehr in Betrieb genommen werden können.
http://www.tagesanzeiger.ch/mobile/ausl ... index.html
_______________________________________________
Gruss
Urbi